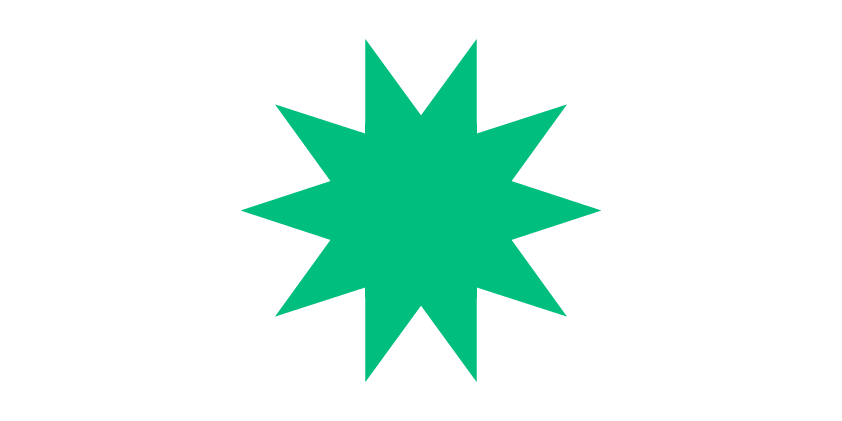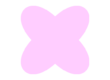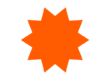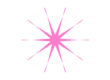Gibt es in deinem Berufsleben auch Begriffe und Sätze, die dich richtig auf die Palme bringen? Mir ist vor einigen Wochen mal wieder einer begegnet, und sein Trigger-Level hat mich selbst überrascht. Es ging um meine Workshops über Innovation und Produktentwicklung im Journalismus und mein Gegenüber sagte etwas wie:
“Und dann zeigst du bestimmt auch Best Practice Cases, oder?”
Ein total freundlicher, harmloser Satz. Und ich kochte innerlich, stundenlang.
Abkupfern verhindert Innovation
Ich bin nämlich davon überzeugt, dass der Journalismus viel zu lange auf erfolgreiche Beispiele geschielt und von anderen abgekupfert hat, um sich bei minimalem Risiko vermeintlich weiterzuentwickeln. Es ist ja auch so schön einfach: “Oh, bei xy hat es funktioniert, dann machen wir das jetzt auch so.” Ich habe das bei Themen, Formaten und Produkten erlebt. Und so konkurrieren Journalist*innen bei Tiktok und Instagram mit Influencer*innen und rennen jedem Trend hinterher, anstatt sich etwas Neues für die Menschen auszudenken, die sie mit ihren Angeboten tatsächlich erreichen.
Diese Haltung ist nicht nur ein bisschen faul, feige und einfallslos, sondern sie verhindert echte Neuerungen. Sie führt dazu, dass wir uns nur um die komplizierten Probleme kümmern (Beispiel: “Wie werden wir erfolgreich auf Youtube?”), und nicht um die komplexen Probleme (Beispiel: “Wie können wir als Medium Menschen in unserer Demokratie zu mehr Teilhabe verhelfen?”). Und im Fall eines Workshops verplempert diese Einstellung wertvolle Zeit, in der man sich auch um die eigenen Belange kümmern könnte.
Tools sind keine Garantie
Ich kann den Wunsch nach Best Practices sogar verstehen: Wenn man sich in einen Innovationsprozess wirft, sind dort sehr lange vor allem viele Fragen. Und man möchte auch so sicher wie möglich sein, dass die ausgewählten Methoden, Tools und Wege auch zum Erfolg führen. Nur: Eine solche Versicherung gibt es nicht. Das tollste Tool, das bei allen anderen “funktioniert” hat, kann in deinem Fall veröden. Und vollkommen planlos können die besten Ideen auftauchen und umgesetzt werden. Sie werden erfolgreich, weil andere Menschen von ihnen begeistert sind, nicht weil du drei Monate zuvor eine gute Roadmap aufgesetzt und Meilensteine bestimmt hast.
Was gegen diese Angst vorm Scheitern, das Klammern an Pseudo-Sicherheiten helfen kann? Kleine Schritte – und die Grundsätze der Effectuation. Wissenschaftler der Carnegie Mellon University haben schon vor 14 Jahren angefangen zu erforschen, was Startups so erfolgreich macht.
Voilà, das sind die fünf Prinzipien der Effecuation
Bird in Hand: Erfolgreiche Entrepreneure fangen mit dem an, was sie haben und gut können. Sie konzentrieren sich auf die Ressourcen, zu denen sie leicht Zugang haben.
Affordable Loss: Die Frage ist nicht: “Was will ich in fünf Jahren erreichen?” Sondern: “Was bin ich bereit, einzusetzen – und vielleicht zu verlieren?” Ein riesiger Unterschied, vor allem wenn man im Kopf behält, dass man manche unerfolgreiche Ideen, Projekte oder Produkte irgendwann für tot erklären sollte.
Lemonade: Bei diesem Prinzip geht es um die sprichwörtlichen Zitronen und die Limonade. Erfolgreiche Entrepreneure setzen auf den Zufall und das Ungeplante – und versuchen, das Beste aus den Umständen zu machen.
Crazy Quilt: Gerade am Anfang einer Idee geht es darum, möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, Kunden zu finden Kontakte zu knüpfen, Partnerschaften zu bilden. Das Feedback ist unermesslich wichtig.
Pilot in the plane: Erfolgreiche Entrepreneure konzentrieren sich auf die Dinge, die sie kontrollieren können. Sie glauben daran, dass sie die Zukunft gestalten können.
Du hast den Trick bemerkt, oder? Effectuation, das sind quasi destillierte Best Practice Cases. Die Lehren ohne die einzelnen Fälle und Produkte. Und mit denen bin ich dann wieder versöhnt.
Übrigens: Dieser Text ist zuerst in meinem Newsletter Haftnotiz erschienen. Wenn er dir gefallen hat, melde dich für die Haftnotiz an.