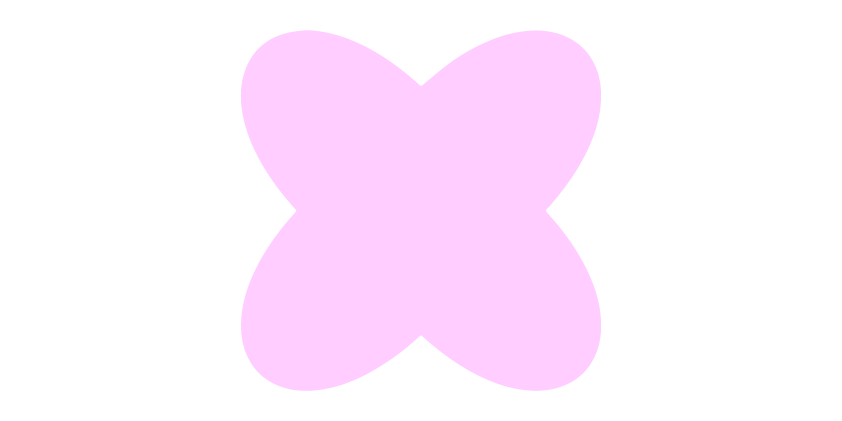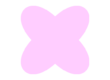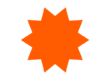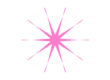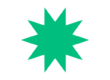Empathie für die Zielgruppe entwickeln und auf diesen Erkenntnissen journalistische Formate oder auch nur die nächste Artikel-Idee aufbauen – das klingt smart, stringent. Außerdem unwiderstehlich modern. Wie etwas, das man gern auf einer Bühne beiläufig erwähnt. Wahr ist aber auch: Diese Empathie kann sich chaotisch anfühlen. Wo fängt man an?
Empathie im Journalismus – so geht’s
Empathie entsteht, indem wir Fragen stellen, gut zuhören und Antworten suchen.
- Wie sieht der Alltag der Menschen in deiner Community oder deiner Zielgruppe aus?
- Was sehen und hören sie jeden Tag? Autos? Kinder? Pferde? Backwaren? Yecca? Danger Dan? Helene Fischer?
- Welche alltäglichen Aufgaben meistern sie? An welchen Herausforderungen scheitern sie?
- Wie sehen ihre Wünsche und Träume aus? Was wollen Sie im Leben erreichen?
- Und wovor haben sie Angst? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
Diese Meta-Fragen stelle ich oft in Design Sprints und Workshops. Mit journalistischen Angeboten können wir darauf reagieren: Lösungen und Wege anbieten, den Ängsten Fakten gegenüberstellen, Aufgaben erleichtern oder sogar ganz abnehmen. Und das ganze so, dass es in den Alltag passt. Diese Fragen ungefiltert an die Zielgruppenmenschen weiterzugeben, ist allerdings keine gute Idee. “Entschuldigung, wir kennen uns gar nicht, ich schreibe normalerweise Dinge ins Internet, aber jetzt möchte ich gern wissen: Wovor haben Sie eigentlich am meisten Angst? Und nehmen Sie Ihr Handy auch mit aufs Klo?” Das geht schief. Wir müssen uns aufwärmen, herantasten, Vertrauen schaffen. Und hier hakt es oft.
Informationsvampire und „Askholes“
“Neugierig – bin ich. Fragen stellen – kann ich”, sagt wahrscheinlich jede*r Journalist*in über sich. Aber stellen wir auch die interessanten? Seitdem ich 2018 Design Thinking kennen gelernt und nach und nach zur Grundlage meiner Arbeit gemacht habe, treibt mich diese Frage um. Journalistisch fragen, das heißt oft: einkesseln, zuspitzen, schnell zum Punkt kommen, paraphrasieren, aussaugen. Geschichten und Zitate jagen. Wir sind Informationsvampire.
“Fraglöcher” nennt Sebastian Esser Journalist*innen mit dieser Haltung in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters “Blaupause”. Er hat das Wort nicht erfunden, er hat die Hearken-Gründerin Jennifer Brandel übersetzt. Und auf englisch klingt’s noch schöner: “Askholes” ist schließlich nur einen Buchstaben von einer Beleidigung entfernt. Askholes fragen egoistisch und mit einem Blick auf den eigenen Gewinn, ohne sich für die gewonnene Perspektive zu bedanken, ohne echten Austausch.
Wonach man fragen kann
Als Journalist*innen können wir Wissen, Erfahrungen und Geschichten sammeln: “Was sollten andere auch wissen? Erinnern Sie sich noch an …? Wie war das? Was genau war so bemerkenswert? Warum?” Und wir können verantwortungsbewusst mit diesen Informationen umgehen, die verschiedenen Perspektiven ernst nehmen.
Das ist zumindest ein Anfang.
Übrigens: Dieser Text wurde zuerst am 26. April 2022 in meinem Newsletter veröffentlicht. Um keinen Text zu verpassen, abonniere die Haftnotiz.